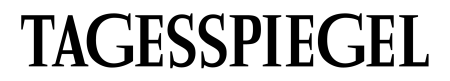Nachruf auf Christiane Kriester (* am 16. Juli 1936)
Als junge Frau und auch noch lange danach ähnelte sie der Schauspielerin Anna Magnani. Das schwarze Haar ungebändigt, um die Augen tiefe Schatten, in den fein geschnittenen Zügen nistete ein alter Schmerz. Auch Christiane Kriester war einmal Schauspielerin. Vieles davon ist ihr geblieben, die Lust am Auftritt, das Geschick, sich in Szene zu setzen. Sie liebte es, wenn das Haus voll war. Wenn die Villa im Grunewald mit ihren Erkern und Salons, der Säulenterrasse und dem verwilderten Garten zur gestaffelten Bühne wurde. Am Ende ihres Lebens, als immer mal wieder Musiker in den weitläufigen Räumen probten, sang sie mit. Manchmal breitete sie dabei die Arme aus, als wolle sie fliegen. Seit einem Autounfall vor zehn Jahren fiel ihr das Sprechen schwer. Eine Gehirnblutung hatte ihr Sprachzentrum beschädigt, allmählich zeigten sich Symptome einer Demenz. Ihr Mann verstand sie, wenn sie nach Worten rang, in ihren letzten Jahren pflegte er sie.
Er war ihr zweiter Ehemann, eine Generation jünger als sie. Mit ihrem ersten, dem Bildhauer Rainer Kriester, hatte sie 40 Jahre lang gelebt. Ohne seine Frau, heißt es, hätte Rainer Kriester nicht in bedeutenden Museen ausgestellt, hätte keine Sammler von Einfluss gefunden. Doch die meisten, die das Paar kannten, sprechen hartnäckig von ihm, wenn man nach ihr fragt. Als zähle sie nur in Verbindung mit ihm. Spielte sie die Rolle der Künstlergattin, die als Türhüterin ebenso hofiert wie gefürchtet wird, selbst aber immer im Schatten bleibt?
Als sie die Schauspielerei aufgab, war sie knapp 40 und beschloss, Geschäftsfrau zu sein: Managerin ihres Mannes, PR-Agentin. Sie hatte Freude daran. In einem Zimmer hinter der Küche richtete sie sich ihr Büro ein, von einem Studenten ließ sie sich die Arbeit am PC erklären. Zusammen mit Kunsthistorikern erstellte sie Kataloge, sie verwaltete die Finanzen. Es lief gut. Seit Ende der 70er Jahre waren Kriesters Kopfskulpturen aus Bronze, Holz und Stein sehr gefragt, auch der Staat kaufte seine Kunst. Eine Kalksteinskulptur mit dem Titel „Großes weißes Kopfzeichen“ steht im Bundeskanzleramt. Einen Galeristen mit Exklusivansprüchen wollten die Kriesters nicht. Als symbiotisches Paar verpuppten sie sich bei allem Trubel in einem für andere schwer zu durchdringenden Kokon.
Bei einer Party hatte der Kunststudent die Schauspielerin kennengelernt. Sie konnte etwas, das ihm schwerfiel: Leute ansprechen, Verbindungen schaffen, Orte finden, an denen es sich gut arbeiten ließ. Sie war es, die zu Beginn der 60er Jahre die Villa entdeckt hatte, einen von außen grobschlächtigen, zweistöckigen Quader, unbewohnt wie damals so viele Häuser in Grunewald. Die Villa gehört bis heute dem Land Berlin. Tagelang soll Christiane Kriester damals das Bezirksamt belagert haben, ohne Erfolg. Bis sie eines Abends Willy Brandt aus einer Kneipe in der Lietzenburger Straße kommen sah. Sie sprach ihn an, sie suche ein Atelierhaus für ihre Freunde, alles Künstler und Schauspieler, sie bräuchten die Villa, unbedingt. Der Regierende Bürgermeister verschaffte ihr und den Freunden das Haus. Er soll dann auch ein paar Mal zu Gast gewesen sein. Einen der vielen Hunde, die Christiane Kriester im Lauf des Lebens hatte, nannte sie denn auch Willy. Einen Schäferhundmischung, kleine Hunde mochte sie nicht.
Die Schauspielerei? Einmal hatte sie sich vor einem Regisseur ausziehen sollen, er müsse ihre Figur sehen, um sie besetzen zu können. Da hatte sie sich umgedreht und war gegangen. Spuren aus ihrer Theaterzeit sind kaum geblieben, ein paar Verdienstbescheinigungen der Freien Volksbühne in der Schaperstraße, 1962 waren es 638 Mark in den Monaten September bis Dezember, und die Lohnzettel der Filmfirmen, für die sie amerikanische Fernsehserien synchronisiert hatte. Auch ein paar Zeitungsausschnitte hat sie aufbewahrt, wie den über „Rockys Messer“, eine Berliner Jugendbandengeschichte, 1966 in Kreuzberg und Wilmersdorf gedreht. Sie im Trenchcoat, die Hände in den Taschen, bedrängt von einem Halbstarken: „Scheinwerfer im nächtlichen Preußenpark. Ein Mädchen fühlt sich verfolgt“, steht unter dem grobkörnigen Foto, ihr Name fehlt.
Damals hieß sie noch Christiane Daß. Sie war Hamburgerin, Tochter einer gebildeten Familie aus dem bürgerlichen Stadtteil Lokstedt. Ihre Mutter starb, als sie neun war, mit der Stiefmutter verstand sie sich nicht. So schickte sie der Vater, ein Musikprofessor, zu einer Tante aufs Land. Vielleicht rührte daher ihre Distanziertheit, ja Ablehnung gegenüber Frauen. Immer waren es Männer, mit denen sie Bündnisse einging. Erst Mitte der 80er Jahre fand sie bei den Frauen eines italienischen Dorfes eine Wärme, die sie mit frühen Kränkungen versöhnte. Es gibt eine Fotografie von ihr aus dieser Zeit, sie ganz in Weiß, gelöst lächelnd, den Mann an der Hand.
Sie hatte es nicht leicht mit seinen Stimmungsschwankungen zwischen Depression und manischer Arbeitswut, mit seiner Ignoranz gegenüber ihrem Wunsch nach einem komfortableren Leben. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie sich nicht einmal Möbel angeschafft. Auch er, der als Kind im Krieg schwer traumatisiert worden war, fand in Italien eine Art inneren Frieden. In den 80ern kauften sie sich in Ligurien ein Bauernhaus und verbrachten die Sommermonate dort. Im nahe gelegenen Steinbruch fand er das Material für seine meterhohen Stelen. Auf einem lichtüberströmten Hochplateau in Castellaro hinterließ er einen Skulpturenpark.
Im Mai 2002 starb Rainer Kriester. Seine Witwe gründete die „Fondazione Kriester“ und machte den Skulpturenpark zur Arena für Konzerte und Theaterinszenierungen, sie förderte junge Künstler und wurde eine auch im Italienischen eloquente Impresaria. Wie zuvor organisierte sie Ausstellungen, bald gemeinsam mit dem Mann, der dem Künstler eine Zeit lang assistiert hatte.
Ihm, der ihr zweiter Ehemann wurde, war sie nach einem Ausrutscher auf der Kellertreppe in die Arme gefallen. „Daran kann man sich aber gewöhnen“, sagte sie zu ihm. Ob sie das inszeniert hatte? Mag sein. Es wurde eine lange Liebesgeschichte. Sollten doch die Leute reden.
An einem Sonntagmorgen ist sie in der Villa gestorben, in einem kleinen Seitenzimmer, das Fenster zum Garten war offen. An den Wänden hingen die Fotografien aus der Zeit ihrer ersten Verliebtheit mit dem zweiten Mann. Christina Bylow
Er war ihr zweiter Ehemann, eine Generation jünger als sie. Mit ihrem ersten, dem Bildhauer Rainer Kriester, hatte sie 40 Jahre lang gelebt. Ohne seine Frau, heißt es, hätte Rainer Kriester nicht in bedeutenden Museen ausgestellt, hätte keine Sammler von Einfluss gefunden. Doch die meisten, die das Paar kannten, sprechen hartnäckig von ihm, wenn man nach ihr fragt. Als zähle sie nur in Verbindung mit ihm. Spielte sie die Rolle der Künstlergattin, die als Türhüterin ebenso hofiert wie gefürchtet wird, selbst aber immer im Schatten bleibt?
Als sie die Schauspielerei aufgab, war sie knapp 40 und beschloss, Geschäftsfrau zu sein: Managerin ihres Mannes, PR-Agentin. Sie hatte Freude daran. In einem Zimmer hinter der Küche richtete sie sich ihr Büro ein, von einem Studenten ließ sie sich die Arbeit am PC erklären. Zusammen mit Kunsthistorikern erstellte sie Kataloge, sie verwaltete die Finanzen. Es lief gut. Seit Ende der 70er Jahre waren Kriesters Kopfskulpturen aus Bronze, Holz und Stein sehr gefragt, auch der Staat kaufte seine Kunst. Eine Kalksteinskulptur mit dem Titel „Großes weißes Kopfzeichen“ steht im Bundeskanzleramt. Einen Galeristen mit Exklusivansprüchen wollten die Kriesters nicht. Als symbiotisches Paar verpuppten sie sich bei allem Trubel in einem für andere schwer zu durchdringenden Kokon.
Bei einer Party hatte der Kunststudent die Schauspielerin kennengelernt. Sie konnte etwas, das ihm schwerfiel: Leute ansprechen, Verbindungen schaffen, Orte finden, an denen es sich gut arbeiten ließ. Sie war es, die zu Beginn der 60er Jahre die Villa entdeckt hatte, einen von außen grobschlächtigen, zweistöckigen Quader, unbewohnt wie damals so viele Häuser in Grunewald. Die Villa gehört bis heute dem Land Berlin. Tagelang soll Christiane Kriester damals das Bezirksamt belagert haben, ohne Erfolg. Bis sie eines Abends Willy Brandt aus einer Kneipe in der Lietzenburger Straße kommen sah. Sie sprach ihn an, sie suche ein Atelierhaus für ihre Freunde, alles Künstler und Schauspieler, sie bräuchten die Villa, unbedingt. Der Regierende Bürgermeister verschaffte ihr und den Freunden das Haus. Er soll dann auch ein paar Mal zu Gast gewesen sein. Einen der vielen Hunde, die Christiane Kriester im Lauf des Lebens hatte, nannte sie denn auch Willy. Einen Schäferhundmischung, kleine Hunde mochte sie nicht.
Die Schauspielerei? Einmal hatte sie sich vor einem Regisseur ausziehen sollen, er müsse ihre Figur sehen, um sie besetzen zu können. Da hatte sie sich umgedreht und war gegangen. Spuren aus ihrer Theaterzeit sind kaum geblieben, ein paar Verdienstbescheinigungen der Freien Volksbühne in der Schaperstraße, 1962 waren es 638 Mark in den Monaten September bis Dezember, und die Lohnzettel der Filmfirmen, für die sie amerikanische Fernsehserien synchronisiert hatte. Auch ein paar Zeitungsausschnitte hat sie aufbewahrt, wie den über „Rockys Messer“, eine Berliner Jugendbandengeschichte, 1966 in Kreuzberg und Wilmersdorf gedreht. Sie im Trenchcoat, die Hände in den Taschen, bedrängt von einem Halbstarken: „Scheinwerfer im nächtlichen Preußenpark. Ein Mädchen fühlt sich verfolgt“, steht unter dem grobkörnigen Foto, ihr Name fehlt.
Damals hieß sie noch Christiane Daß. Sie war Hamburgerin, Tochter einer gebildeten Familie aus dem bürgerlichen Stadtteil Lokstedt. Ihre Mutter starb, als sie neun war, mit der Stiefmutter verstand sie sich nicht. So schickte sie der Vater, ein Musikprofessor, zu einer Tante aufs Land. Vielleicht rührte daher ihre Distanziertheit, ja Ablehnung gegenüber Frauen. Immer waren es Männer, mit denen sie Bündnisse einging. Erst Mitte der 80er Jahre fand sie bei den Frauen eines italienischen Dorfes eine Wärme, die sie mit frühen Kränkungen versöhnte. Es gibt eine Fotografie von ihr aus dieser Zeit, sie ganz in Weiß, gelöst lächelnd, den Mann an der Hand.
Sie hatte es nicht leicht mit seinen Stimmungsschwankungen zwischen Depression und manischer Arbeitswut, mit seiner Ignoranz gegenüber ihrem Wunsch nach einem komfortableren Leben. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie sich nicht einmal Möbel angeschafft. Auch er, der als Kind im Krieg schwer traumatisiert worden war, fand in Italien eine Art inneren Frieden. In den 80ern kauften sie sich in Ligurien ein Bauernhaus und verbrachten die Sommermonate dort. Im nahe gelegenen Steinbruch fand er das Material für seine meterhohen Stelen. Auf einem lichtüberströmten Hochplateau in Castellaro hinterließ er einen Skulpturenpark.
Im Mai 2002 starb Rainer Kriester. Seine Witwe gründete die „Fondazione Kriester“ und machte den Skulpturenpark zur Arena für Konzerte und Theaterinszenierungen, sie förderte junge Künstler und wurde eine auch im Italienischen eloquente Impresaria. Wie zuvor organisierte sie Ausstellungen, bald gemeinsam mit dem Mann, der dem Künstler eine Zeit lang assistiert hatte.
Ihm, der ihr zweiter Ehemann wurde, war sie nach einem Ausrutscher auf der Kellertreppe in die Arme gefallen. „Daran kann man sich aber gewöhnen“, sagte sie zu ihm. Ob sie das inszeniert hatte? Mag sein. Es wurde eine lange Liebesgeschichte. Sollten doch die Leute reden.
An einem Sonntagmorgen ist sie in der Villa gestorben, in einem kleinen Seitenzimmer, das Fenster zum Garten war offen. An den Wänden hingen die Fotografien aus der Zeit ihrer ersten Verliebtheit mit dem zweiten Mann. Christina Bylow